Schrankensteuerungen
mit Gleiskontakten -
eher ein Notbehelf !
Alle
kontakt-gesteuerten
Automatiken haben prinzipielle Nachteile: Bei
Verwendung von Reedkontakten darf der
schaltende Magnet pro Zug nur einmal vorhanden sein, im
allgemeinen an der Lok, da
sonst kaum
unterschiedliche Garnituren zusammengestellt werden können. Da
die Schrankenmechanik
eine gewisse Zeit zum Öffnen und Schließen
braucht (besonders die sehr vorbildlich bewegten Schranken mit
motorischem
Antrieb), müssen die Gleiskontakte in ausreichendem Abstand
vor und hinter dem
Übergang angeordnet werden. Und hier beginnt das Dilemma:
Passiert die Lok den ersten
Schaltkontakt, so
wird die Schranke sich - bei richtigem Abstand - rechtzeitig
schließen.
Passiert die Lok nun den für das Öffnen
zuständigen Kontakt jenseits des
Überweges, wird sich die Schranke unweigerlich
öffnen, egal, ob erst der halbe
Zug den Übergang passiert hat. Also wird man die
Öffnungskontakte sehr weit
vom Übergang entfernt platzieren. Und was geschieht jetzt bei
einer
Lok-Leerfahrt: die Schranken öffnen sich zu
spät! Je unterschiedlicher
die Länge der Züge, die auf dem Gleisabschnitt
verkehren, desto
vorbild-unähnlicher wird die Situation. Und zweitens: werden
auf der Anlage
auch noch Wendezüge eingesetzt, so würde die
schiebende Lok erst dann die
Schranken schließen, wenn der Zug den Überweg
möglicherweise schon halb
passiert hat. Der Ausweg: auch die Schließkontakte
müssten weit vor den
Überweg verlegt werden. Die Wirkung bei Zügen mit der
Lok voran ist dann ganz
analog zu der für das verspätete Schließen
beschriebene Szenario.
Fazit:
Die Steuerung eines Schrankenübergangs mit Hilfe von
Gleiskontakten ist keine gute Lösung, nicht zuletzt
auch
wegen der Unsicherheit von zugbeeinflussten Kontakten. Eine bessere
Lösung bietet da eine
Schrankensteuerung
auf der Basis einer Fahrtrichtungs-Erkennung, wie die auf der Seite "Schrankenautomatik"
beschriebene Lichtschrankensteuerung.
Wie ist eine Schrankensteuerung mit
Hilfe von Gleiskontakten prinzipiell zu realisieren?
Das
direkte Ansteuern der Schrankenantriebe durch Gleiskontakte stellt auch
deshalb eine unsichere Lösung dar, weil die
Schaltimpulse beim
Überfahren der Kontakte - abhängig von der
Zugegeschwindigkeit - recht kurz sind. Besser ist es
deshalb,
die Schrankenantriebe über Relais zu schalten, deren
Stellung von Gleiskontakten beeinflusst wird. Hier können
entweder bistabile
Relais (Doppelspulen-Relais) verwendet werden, oder auch monostabile
Relais bei
Anwendung einer Selbsthalteschaltung.
1.
Verwendung eines bistabilen Relais
Die
beiden Gleiskontakte a1 und a2 öffnen die Schranken, z1 und z2
sorgen für das
Schließen:
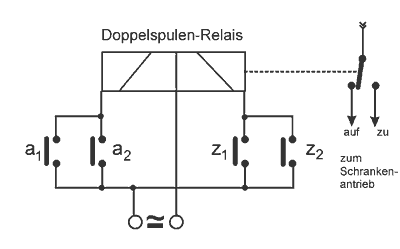 Skizze 1: Schaltung mit
Doppelspulen-Relais Skizze 1: Schaltung mit
Doppelspulen-RelaisDie
Anordnung dieser vier Gleiskontakte
für zweigleisigen Einrichtungsbetrieb und
eingleisigen Zweirichtungsbetrieb zeigen die folgenden Skizzen 2 und 3:
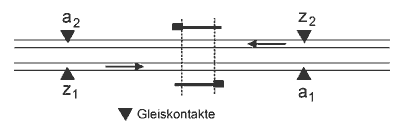 Skizze 2: Zweigleisiger Einrichtungsbetrieb Skizze 2: Zweigleisiger Einrichtungsbetrieb
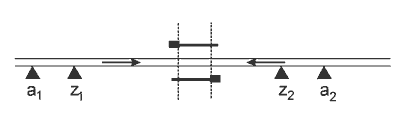 Skizze 3: Eingleisiger Zweirichtungsbetrieb Skizze 3: Eingleisiger Zweirichtungsbetrieb
Gegenüber
den üblichen Kontaktgleisen sind Reed-Kontakte
(Schutzgas-Rohrkontakte) als
Impulsgeber noch am besten geeignet, da sie die
größte
Schaltsicherheit bieten. Der
Nachteil ist, dass alle Lokomotiven bzw. Steuerwagen mit kleinen
Magneten
ausgestattet werden müssen.
2.
Verwendung eines monostabilen Relais
Diese
in der Elektronik üblichen Relais haben den Vorteil, dass sie
(im Unterschied zu den
"stromfressenden" und teuren Modellbahn-Relais) im allgemeinen eine
vergleichsweise geringe Stromstärke zum Schalten
benötigen; darüber hinaus
sind sie erheblich billiger als bistabile Relais. Hier ist eine
Selbsthalte-Schaltung nach der folgenden Schaltskizze geeignet:
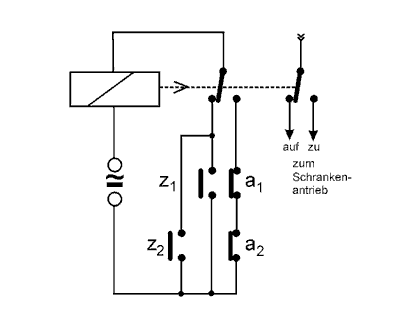 Skizze 4: Schaltung mit monostabilem Relais Skizze 4: Schaltung mit monostabilem RelaisDie
beiden parallel geschalteten Kontaktpaare z1/z2 lassen das Relais
anziehen, über den 2. Kontaktsatz
des Relais wird die Schranke geschlossen. Die beiden in Reihe
geschalteten Kontakte a1/a2 sorgen dafür, dass
das Relais sich selbst hält, bis einer der beiden Kontakte
durch eine daran
vorbeifahrende Lok geöffnet wird. Dann fällt das
Relais ab und die Schranken
werden geöffnet. Die Anordnung der Kontakte am Gleis
entspricht den Skizzen 2 und 3 weiter oben.
3.
Elektronische Relaissteuerung
Um
die Schaltsicherheit zu erhöhen und um Reed-Kontakte verwenden
zu können, die
sehr klein sind (und deshalb nur geringe Ströme schalten
können), kann die
Relais-Steuerung verbessert werden, wenn man mit Hilfe von zwei
Transistoren und
von ein paar Widerständen eine bistabile Kippschaltung
(Flip-Flop) nach der folgenden Schaltskizze
verwendet. Hier kann sogar ganz auf ein elektromechanisch schaltendes
Relais
verzichtet werden, wenn zum Schalten die Transistoren T3 und T4
verwendet
werden. Je nach benötigter Stromstärke werden hier
Kleinleistungstransistoren
verwendet. Soll ein Schaltrelais eingesetzt werden, so ist dieses statt
R1
anzuschließen; die Transistoren T3 und T4, die
Widerstände R7 und R8 und die Dioden D entfallen dann. Auch
hier ist die Anordnung der vier Gleiskontakte wie in den Skizzen 2 und
3 weiter oben. Da die Kondensatoren C1 und C2
unterschiedliche
Kapazitäten haben, hat die Kippstufe eine Vorzugsstellung, die
sie beim
Einschalten der Versorgungsspannung einnimmt. Diese Vorzugsstellung
sollte mit
der Schrankenstellung "offen" zusammenfallen. Die Dioden D
(parallel zu T3 und T4) müssen eingesetzt werden, wenn ein
elektromagnetischer
Schrankenantrieb angesteuert werden soll, sie schützen die
Transistoren vor
Spannungsspitzen, die beim Ausschalten des Stromes durch die Spulen
entstehen. Wird ein
elektromagnetischer
Antrieb verwendet, so muss dieser über eine Endabschaltung
verfügen, da sonst
die Spulen durchbrennen. Falls der Antrieb keine Endabschaltung
besitzt, muss
eine Schaltung analog zur Skizze
2 auf der Seite schranken.htm
verwendet werden.
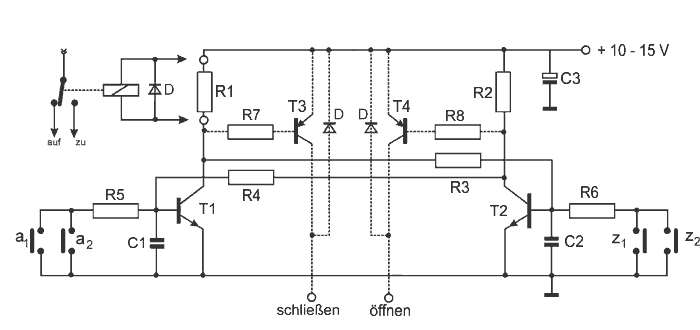
Skizze 5: bistabile Kippstufe
| Bauteile für
die bistabile Kippstufe |
| T1,
T2 |
Universal-npn-Transistor,
z.B. BC 547 |
| T3,
T4 |
Kleinleistungs-pnp-Transistor,
z.B. BC 160 |
| R1,
R2, R5, R6 |
1k0 |
| R3,
R4 |
4k7 |
| R7,
R8 |
1k2 |
| C1 |
10
nF |
| C2 |
22
nF |
| C3 |
Elko
100 µF /35 V |
| D |
Dioden
1N4148 |
| Relais |
10-15
V, ca. 1kOhm, ein Wechser-Kontakt |
|

